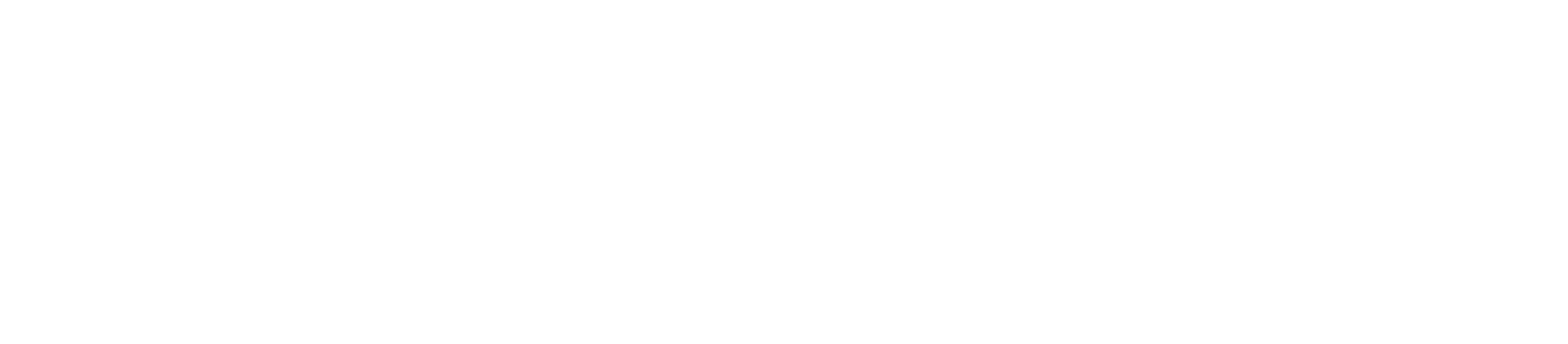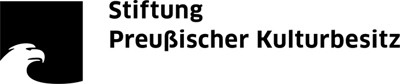Gedenktafeln im Foyer des GStA PK
Gedenktafeln im Foyer des GStA PK
Betritt man das Geheime Staatsarchiv entdeckt man im Foyer zwei Tafeln aus grauem Granit: eine Gedenktafel für die Erbauer des GStA PK sowie eine Gedenktafel für die „Gefallenen der Preußischen Staatsarchive, 1914 – 1918“.

Gedenktafel für die Erbauer des GStA PK
Rechts neben der Eingangstür befindet sich eine auf Veranlassung des Finanzministeriums angebrachte 69 x 38 cm große Tafel, die dem Architekten Dr. Ing. Eduard Fürstenau (1862 - 1938)[1] sowie den für den Bau und die Einrichtung des Archivgebäudes verantwortlichen Regierungs- und Bauräten Georg Emil Krecker (1873 - 1959)[2] und Max Hermann Georg Büssow (1883 - 1951)[3] für ihre langjährigen Leistungen beim Bau und der Einrichtung des Geheimen Staatsarchivs gewidmet ist.
Die Tafel war nach einem Literaturhinweis bereits bei der Eröffnung am 26. März 1924 vorhanden.[4]
Gedenktafel für die „Gefallenen der Preußischen Staatsarchive, 1914 – 1918“
Einige Schritte weiter erblickt man linksseitig eine größere Tafel: Ein schlichtes Ehrenmal, aus dunkelgrauem Granit gemeißelt. Die Gedenktafel mit den Maßen von 104 x 150 cm ist nur mit einem stilisierten Eisernen Kreuz versehen und erinnert an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Bediensteten verschiedener Preußischer Staatsarchive.
Beamte der Preußischen Staatsarchive „beschlossen, zu Ehren der im Weltkriege gefallenen Angehörigen der Archive eine Gedenktafel in der Eingangshalle des Geheimen Staatsarchivs anzubringen.“[5] Für die Herstellung und Anbringung dieser Gedenktafel wurden private Spenden aus der Belegschaft gesammelt. Die Dokumente hinsichtlich deren Gestaltung und Befestigung konzipierte der Regierungs- und Baurat Max Hermann Georg Büssow. Dem Vorhaben erteilte Ministerpräsident Otto Braun am 15. April 1925 seine Zustimmung.[6]
Wer waren die Personen? Die Kurzbiografien geben Auskunft.[7]

Die Volontäre und der Assistent
Dr. Otto Blaul
29.12.1887 – 21.08.1914
Otto Blaul besuchte von 1896 bis 1905 das Großherzogliche Ludwig-Georg-Gymnasium in Darmstadt und studierte anschließend Geschichte, Geographie und Germanistik an den Universitäten Göttingen, Straßburg und Berlin.
Nach der Promotion zum Dr. phil. 1911 in Straßburg mit der Dissertation „Studien zum Register Gregors VII.“ legte er 1912 die Staatsprüfung zum Lehramt an höheren Schulen ab.
Seinen Militärdienst leistete Blaul beim Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiment Nr. 4 in Berlin von April 1913 bis März 1914 und beendete diesen als Reserve-Offiziersanwärter.
Seit 01. April 1914 war er als Volontär im Staatsarchiv Wiesbaden tätig und mit der Anfertigung von Regesten von Urkunden der Deutschordenskommende Sachsenhausen, des Hospitals Klarenthal sowie Nassau-Usingischer Reichslehensurkunden beauftragt.
Anfang 1914 wurde er zum Heer einberufen und ist bei Gefechten in der Nähe von Namur (Belgien) am 21. August 1914 gefallen. Bestattet wurde er in der Kriegsgräberstätte Langemark (Belgien).
Dr. Fritz Boye
22.08.1888 – 20.09.1914
Nach dem Besuch des Domgymnasiums in Magdeburg erhielt Fritz Boye 1907 sein Reifezeugnis und studierte anschließend vermutlich Geschichte in München, Göttingen und Berlin bis 1914. In Berlin wurde er 1914 mit der Dissertation „Über die Poen-Formel in den Urkunden des früheren Mittelalters“ zum Dr. phil. promoviert. Von Oktober 1910 bis Dezember 1912 war er Hilfsarbeiter bei Karl Zeumer in Berlin und seit 01. April 1914 Volontär im Staatsarchiv Magdeburg. Anfang August 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger und wurde am 20. September 1914 als vermisst gemeldet.
Dr. Fritz Ginsberg
12.02.1887 – 17.10.1916
Ginsberg wurde in Struthütten, Kreis Siegen, geboren und erhielt 1907 das Reifezeugnis des Königlichen Gymnasiums in Dillenburg. Von 1907 bis 1912 absolvierte er an der Universität Berlin ein Studium der Geschichte des Mittelalters sowie Latein und Altgriechisch. 1912 promovierte Ginsberg mit der Dissertation „Die Privatkanzlei der Metzer Patrizierfamilie de Heu 1350-1550. I A: Quellenstudien z. Wirtschaftsgeschichted. Metzer Landes“.
Nach einem Volontariat im Staatsarchiv Münster war er seit Mai 1914 als Volontär im Geheimen Staatsarchiv tätig und bestand im Juli die Prüfung als Archivaspirant.
Am 20. August 1914 trat er als Kriegsfreiwilliger in das Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 ein. Nach seiner Verwundung im Oktober 1914 und anschließendem Lazarettaufenthalt kämpfte er wieder an der Front. Ginsberg verstarb am 17. Oktober 1916 nach erneuter Verwundung in Pastomiti (Wolhynien).
Dr. Paul Oberländer
31.03.1892 – 09.10.1915
Oberländer wurde in Lindenau-Friedrichshall bei Heldburg im Kreis Hildburghausen geboren und besuchte von 1904 bis 1910 das Gymnasium Bernhardinum in Meiningen. Ab 1910 studierte er Geschichte, Germanistik und Geografie an den Universitäten Jena, München und Berlin. Nach der Promotion zum Dr. phil. im Februar 1914 in Berlin mit der Dissertation „Hochmeister Friedrich von Sachsen (1498-1519). Teil 1: Wahl und Politik bis zum Tode Johann Albrechts von Polen“ begann er ein Volontariat im Staatsarchiv Stettin. 1914 meldete sich Oberländer als Kriegsfreiwilliger und verstarb beim Sturm auf Belgrad am 09. Oktober 1915.
Dr. Eduard Reibstein
29.06.1875 – 26.09.1914
Nach dem Besuch des Gymnasiums in Stade erhielt Eduard Reibstein 1894 sein Reifezeugnis und studierte bis 1900 Geschichte, Sprachwissenschaften, Kunstgeschichte und Nationalökonomie an den Universitäten Tübingen, Berlin, Göttingen und Marburg. Im Zeitraum 1894 - 1895 leistete er seinen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger beim 1. Hanseatischen Infanterie-Regiment Nr. 75 in Stade, 12. Kompanie und wurde als Reserve-Offiziersanwärter entlassen. Er promovierte im März 1900 in Marburg mit der Dissertation „Heinrich Vorrath, Bürgermeister von Danzig als hanseatischer Diplomat“. Seit Mai 1900 war er Archivvolontär im Staatsarchiv Hannover, in Magdeburg sowie im Geheimen Staatsarchiv und bestand dort im Dezember 1902 die Prüfung als Archivaspirant. Im Oktober 1903 wechselte er als Archivhilfsarbeiter in das Staatsarchiv Königsberg und im Mai 1904 nach Danzig. Im Staatsarchiv Danzig wurde er im Oktober 1904 Archivassistent. Seine weiteren beruflichen Stationen: seit Juni 1905 im Staatsarchiv Magdeburg, seit Juli 1906 im Staatsarchiv Düsseldorf, seit April 1908 im Staatsarchiv Osnabrück, seit Juni 1911 im Staatsarchiv Breslau, seit März 1913 im Staatsarchiv Koblenz. Bei Kriegsbeginn erhielt er die Einberufung als Vizefeldwebel zur 9. Kompanie des Infanterie-Regiments Nr. 68. Im Fronteinsatz in der Nähe von Hurlus in der Champagne wurde er am 26. September 1914 verwundet und gilt seitdem als vermisst.
Dr. Ludwig Tümpel
14.06.1890 – 22.10.1914
Ludwig Tümpel besuchte bis 1909 das Gymnasium in Bielefeld. Nach dem Abitur studierte der Geschichte in Freiburg im Breisgau und in Berlin. Nach seiner Promotion zum Dr. phil. 1914 in Berlin mit der Dissertation „Die Entstehung des brandenburgisch-preußischen Einheitsstaates im Zeitalter des Absolutismus (1609-1806)“ wurde er Volontär im Staatsarchiv Marburg. Im August 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger beim Infanterie-Regiment Graf Bülow von Dennewitz Nr. 55 und verstarb in der Schlacht bei Lille am 22. Oktober 1914.
Die Archivare
Dr. Hermann von Caemmerer
28.08.1879 – 16.09.1914
Geboren in Kassel besuchte Hermann von Caemmerer bis 1897 Gymnasien in Thorn und Konstanz und erhielt sein Reifezeugnis von der Ritterakademie Brandenburg. Von 1897 bis 1901 studierte er Geschichte, Philosophie und klassische Altertumskunde an den Universitäten in Bonn und Berlin. Nach seiner Promotion zum Dr. phil. 1901 in Berlin mit der Dissertation „Das Regensburger Religionsgespräch im Jahre 1546“ war er seit Oktober 1902 Archivvolontär im Geheimen Staatsarchiv und seit Mai 1904 Hilfsarbeiter im Brandenburg-Preußischen Hausarchiv in Charlottenburg. Er bestand seine Archivarsprüfung im Dezember 1904 und war ab Januar 1907 Königlicher Archivar. Im Jahre 1913 wurde er Schriftleiter der „Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte“.
Am 08. August 1914 wurde von Caemmerer als Oberleutnant der Reserve zum Infanterie-Regiment Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin (4. Brandenburgisches) Nr. 24 in Neuruppin eingezogen und kam an die Westfront nach Belgien. Nach einer Verwundung bei einem Gefecht in der Nähe von Aizy/Pargny, nordöstlich von Soissons verstarb er am 16. September 1914.
Dr. Gustav Croon
16.11.1877 – 14.02.1915
Gustav Croon besuchte bis 1897 das Gymnasium in Aachen und studierte im Anschluss bis 1901 Geschichte, Germanistik, Historische Hilfswissenschaften und Kunstgeschichte an den Universitäten Genf, Marburg, München und Berlin. In Marburg promovierte er 1901 mit der Dissertation „Zur Entstehung des Zunftwesens“. Danach besuchte er den Archivarslehrgang und war Einjährig-Freiwilliger bei den Saarbrücker Ulanen.
Seit Oktober 1902 war er als Volontär im Staatsarchiv Düsseldorf und von Januar 1903 bis Oktober 1904 im Staatsarchiv Koblenz tätig. Weitere Stationen: ab April 1905 Archivhilfsarbeiter im Staatsarchiv Wiesbaden; ab Oktober im Staatsarchiv Breslau und dort ab April 1906 als Archivassistent. Croon wechselte im April 1912 als Archivar an das Staatsarchiv Düsseldorf und war bis 1914 zur Ordnung des Archivs des Provinzialverbandes der Rheinprovinz beurlaubt. Er erhielt die Einberufung zur Landwehr-Kavallerie als Oberleutnant der Reserve und verstarb beim Fronteinsatz am 14. Februar 1915 bei Pont-à-Mousson und wurde bestattet in der Kriegsgräberstätte in Fey (Frankreich), Grab 569.
Dr. Max Foltz
22.01.1878 – 27.03.1915
Max Foltz wurde in Duisburg geboren und erhielt 1895 am dortigen Gymnasium sein Reifezeugnis. Von 1895 bis 1898 absolvierte er ein Studium der klassischen Philologie, Geschichte und Germanistik in Heidelberg, Berlin und Marburg. Dort promovierte Foltz 1899 mit der Dissertation „Beiträge zur Geschichte des Patriziats in den deutschen Städten vor dem Ausbruch der Zunftkämpfe (Straßburg, Basel, Worms, Freiburg i. Br.)“. Bereits von Oktober 1898 bis März 1899 war er mit Ordnungsarbeiten am Fürstlich Waldeckischen Archiv im Staatsarchiv Marburg beschäftigt. Dort wurde er im Januar 1900 Volontär, im Juni 1902 Hilfsarbeiter auf Probe und im September 1902 Archivhilfsarbeiter. Im Mai 1903 wechselte Foltz an das Staatsarchiv Danzig und wurde im Oktober 1904 Archivassistent. Seinen einjährigen Militärdienst leistete er in Mülheim an der Ruhr 1903 bis 1904 und wurde als Offiziersanwärter der Reserve entlassen. Seit April 1908 arbeitete Max Foltz als Archivar im Staatsarchiv Danzig und wurde im November 1909 an das Staatsarchiv Düsseldorf versetzt. Anfang September 1914 erhielt Foltz die Einberufung als Leutnant in das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 130 und ist im Fronteinsatz am 27. März 1915 in Combres (Frankreich) gefallen. Bestattet wurde er in der Kriegsgräberstätte Maizeray (Frankreich), Block 2 Grab 419.
Dr. Gustav Kling
22.07.1882 – 26.06.1917
Geboren in Weimar erhielt Gustav Kling 1902 sein Reifezeugnis am Gymnasium in Eisenach. Im Anschluss studierte er bis 1906 Geschichte, Philosophie, Historische Hilfswissenschaften, Nationalökonomie und Germanistik an den Universitäten Heidelberg, Kiel und Berlin. Seine Promotion zum Dr. phil. in Berlin erfolgte mit der Dissertation „Die Schlacht bei Nikopolis im Jahre 1396“. Von 1907 bis 1908 leistete er seinen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger beim Füsilier-Regiment Generalfeldmarschall Gf. Blumenthal Nr. 36, 4. Kompanie in Magdeburg, den er als Unteroffizier der Reserve und Reserveoffiziant beendete. Von April bis Oktober 1908 arbeitete Kling als Archivvolontär im Staatsarchiv Magdeburg und ab November am Geheimen Staatsarchiv in Berlin. Dort legte er 1909 seine Prüfung als Archivaspirant ab und wurde zum Oktober 1909 an das Staatsarchiv Wiesebaden versetzt. Hier war er seit Oktober 1910 Archivhilfsarbeiter, seit Oktober 1911 Archivassistent. Im Oktober 1913 wurde Kling an das Staatsarchiv Koblenz versetzt und 1917 zum Archivar befördert. Im August 1914 erhielt er die Einberufung als Offiziersstellvertreter zum 3. Bataillon des Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 25 (seit November 1914 zum Leutnant der Reserve befördert), zuletzt Kompanie-Führer der 3. Kompanie des Infanterie-Regiments Nr. 459. Kling ist gestorben 1917 im Fronteinsatz in Fontaine-les-Croisilles (südöstlich von Arras, Frankreich).
Dr. Otto Merx
16.05.1862 – 12.09.1916
Geboren in Bleicherode besuchte Otto Merx von 1874 bis 1882 das Gymnasium in Nordhausen. Anschließend absolvierte er ein Studium der Geschichte und Geographie an den Universitäten Halle, Berlin und Göttingen. Seine Promotion zum Dr. phil. erhielt er 1888 in Göttingen mit der Dissertation „Thomas Müntzer und Heinrich Pfeiffer 1523-1525, ein Beitrag zur Geschichte des Bauernkrieges in Thüringen“. Von Oktober 1888 bis September 1889 leistete er seinen Militärdienst beim 2. Hessischen Infanterie-Regiment Nr. 82 und wurde als Reserve-Offizier entlassen. Seit Oktober 1898 war er Archivaspirant im Staatsarchiv Hannover, seit Februar 1893 Archivhilfsarbeiter, seit Mai 1894 Archivassistent. Ab Januar 1898 war er im Geheimen Staatsarchiv Berlin tätig und wurde im Juli als Königlicher Archivar an das Staatsarchiv Magdeburg versetzt. Ab April 1900 arbeitete Merx im Staatsarchiv Osnabrück, seit Oktober 1903 im Staatsarchiv Marburg und seit Oktober 1906 im Staatsarchiv Münster, ab Dezember als Archivrat. Am 20. August 1914 erhielt er seine Einberufung als Leutnant zum Landsturm-Infanterie-Bataillon Münster I (VII.54), zuletzt Hauptmann und Inhaber des Eisernen Kreuzes. Verstorben ist 1916 Merx an einer Gehirnblutung im Festungslazarett Antwerpen und wurde in der Kriegsgräberstätte Vladslo (Belgien), Block 4 Grab 1840 bestattet.
Dr. Felix Rosenfeld
22.04.1872 – 11.04.1917
Felix Rosenfeld wurde in Bromberg geboren und besuchte die Schule in Hirschberg (Schlesien) sowie Gymnasien in Memel und Marburg. Von 1890 bis 1895 studierte er Geschichte, Historische Hilfswissenschaften und Deutsche Philologie an der Universität Marburg. Er promovierte zum Dr. phil. in Marburg 1896 mit der Dissertation „Über die Composition des Liber pontificalis bis zu Papst Constantin I.“. Rosenfeld legte als erster Prüfling das Archivarsexamen an der ein Jahr zuvor errichteten Marburger Archivschule ab. Er wurde im Sommer 1895 vom Einjährig-Freiwilligen Militärdienst befreit und dem Landsturm überwiesen. Von 1895 bis 1897 ordnete er das Archiv des Domkapitels in Naumburg. Im Januar 1898 wechselte er als Archivvolontär an das Staatsarchiv Marburg und im April als Hilfsarbeiter an das Staatsarchiv Magdeburg. Von Juli 1899 bis Juni 1900 war Felix Rosenfeld an das Geheime Staatsarchiv in Berlin abgeordnet. Im April wurde er zum Archivassistenten befördert und wechselte im Juli an das Staatsarchiv Magdeburg. Von Oktober 1899 bis Juni 1900 war Rosenfeld beurlaubt für Arbeiten im Vatikanischen Archiv sowie zur Erstellung des „Repertorium Germanicum“ am Preußischen Historischen Institut in Rom.
1903 wurde er in Magdeburg zum Archivar ernannt und wechselte im April 1908 an das Staatsarchiv Marburg, wo er im Juli 1912 zum Archivrat befördert wurde. Von November bis Dezember 1914 war Rosenfeld in der freiwilligen Krankenpflege tätig, seit September 1915 im Landwehr Infanterie-Regiment Nr. 60. Am 11. April 1917 an der Westfront verwundet, verstarb Rosenfeld im Franziskus-Hospital in Köln-Ehrenfeld. Dort wurde er noch zum Leutnant befördert und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.
Dr. Ernst Salzer
18.02.1876 – 10.11.1915
Ernst Salzer wurde in Worms geboren und besuchte das dortige Gymnasium von 1885 bis 1894. Im Anschluss folgte bis 1899 ein Studium der Rechte, Geschichte und Historischen Hilfswissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Straßburg und Berlin. Er promovierte 1899 in Berlin mit der Dissertation „Die Anfänge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte“. Ab Oktober 1899 leistete er seinen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger beim 33. Feld-Artillerie-Regiment zu Metz, wurde aus gesundheitlichen Gründen bald entlassen und dem Ersatz-Reserve Bezirkskommando III Berlin überwiesen. Ab Mai 1900 war Salzer als Archivvolontär im Geheimen Staatsarchiv Berlin, von Februar bis März 1901 im Staatsarchiv Stettin und seit April 1901 im Staatsarchiv Marburg tätig. Im Juli 1902 absolvierte er die Staatsprüfung für den höheren Archivdienst in Marburg und wechselte im August an das Stadtarchiv Köln. Von April bis September 1903 war Salzer Archivhilfsarbeiter am Preußischen Historischen Institut in Rom. Im Oktober wechselte er an das Staatsarchiv in Danzig und ab Oktober 1904 als Archivassistent an das Geheimes Staatsarchiv Berlin. Seit Mai 1908 war er im Staatsarchiv Stettin tätig und wechselte im September 1908 erneut zum Geheimen Staatsarchiv (seit April 1911 als Königlicher Archivar). Im September 1914 meldete er sich als Freiwilliger zum Dienst bei einer Beratungsstelle des Roten Kreuzes für deutsche Flüchtlinge und im Mai 1915 als Kriegsfreiwilliger bei der 2. Ersatzabteilung des Feld-Artillerie-Regiments Nr. 25 in Darmstadt. Salzer erlitt 1915 im Fronteinsatz eine tödliche Kopfverletzung durch Granatsplitter bei Kruševac (Serbien).
Dr. Emil Theuner
16.12.1857 – 26.09.1914
Emil Theuner wurde in Mildenau (Miłowice), Kreis Sorau, geboren und besuchte das Gymnasium in Görlitz bis zum Abitur 1877. Im Anschluss studierte er Mathematik, später Geschichte an den Universitäten München und Berlin. 1887 promovierte er zum Dr. phil. mit der Dissertation „Der Übergang der Mark Brandenburg vom Wittelsbachischen auf das Luxemburgische Haus“. Von Oktober 1883 bis September 1884 leistete er seinen Militärdienst in der 9. Kompanie des 3. Garde-Regiments zu Fuß und war seit 1905 Hauptmann der Reserve. Von März 1886 bis April 1889 arbeitete er für die „Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven“ (Ältere Universitätsmatrikeln). Im April 1889 wechselte er als Archivaspirant an das Staatsarchiv Düsseldorf, ab Juli als Hilfsarbeiter an das Staatsarchiv Magdeburg und wurde dort im Oktober zum Archivassistenten befördert. Während seiner Beurlaubung von April bis Juli 1892 recherchierte er Material für eine Geschichte der Niederlausitz. Im Juli 1897 wurde er zum Archivar ernannt und wechselte im November an das Staatsarchiv Marburg und im Juli 1902 zum Staatsarchiv Münster, wo er 1906 zum Archivrat befördert wurde.
Seit April 1910 war er im Staatsarchiv Hannover, zuletzt als Stellvertreter des Direktors, tätig und bat im November 1911 aus gesundheitlichen Gründen um seine Entlassung. Theuner wurde im April 1912 pensioniert. Im August 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger im 3. Garde-Regiment zu Fuß und verstarb im Fronteinsatz bei Saint Léonard (französische Vogesen).
Die Kanzleimitarbeiter
Hermann Groth
08.02.1876 – 23.10.1916
Geboren in Sageritz, Kreis Stolp, besuchte Hermann Groth bis zum 14. Lebensjahr die Schule und erhielt anschließend ein Jahr Privatunterricht. Darauf arbeitete er im väterlichen Betrieb. Von 1893 bis 1899 leistete er seinen Militärdienst beim Feldartillerie-Regiment Nr. 36 in Danzig als Dreijährig-Freiwilliger und wurde 1898 zum Sergeant befördert. Nach einem Sturz vom Pferd 1899 wurde er als Militärinvalide entlassen und begann im Mai als Kanzleischreiber bei der Artillerie-Werkstatt in Danzig. Im Zeitraum von 1900 bis April 1901 arbeitete er als Kanzleihilfsarbeiter bei der Einkommenssteuerverwaltung Danzig, seit Mai 1901 als Kanzleihilfsarbeiter beim Staatsarchiv Danzig und seit April 1905 als Kanzleisekretär. Ende August 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger in der Ersatzabteilung des Feldartillerie-Regiments 36 und wurde dort im November 1914 zum Vizewachtmeister und im Mai 1916 zum Offiziersstellvertreter befördert. Groth verstarb im selben Jahr nach einer Verwundung bei Riencourt und wurde in der Kriegsgräberstätte Neuville-St. Vaast (Frankreich), Block 5 Grab 1218 beerdigt.
Hermann Meggers
20.10.1877 – 01.02.1917
Hermann Meggers wurde in Lunden, Kreis Norder-Dithmarschen, geboren und besuchte von 1884 bis 1893 die Bürgerschule und außerdem während der Winterhalbjahre 1889 bis 1902 die Fortbildungsschule in Flensburg. Im Zeitraum von 1893 bis 1898 war er zudem Bürogehilfe bei dem Flensburger Rechtsanwalt Justizrat Ebsen. Von 1898 bis 1911 leistete Meggers seinen Militärdienst in der 3. Eskadron des Husaren-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich (Schleswig-Holsteinisches) Nr. 16 und wurde als Vizewachtmeister entlassen. Während der Militärzeit absolvierte er ab Juli 1901 eine Ausbildung als Zahlmeister und wurde im November 1903 zum Infanterie-Regiment von Manstein (Schleswigsches) Nr. 84 sowie im März 1904 zur Intendantur der 18. Division in Flensburg abkommandiert. Nach dem Zahlmeisterexamen 1905 wurde er Offiziant in der Kassenverwaltung seines Truppenteils und arbeitete ein halbes Jahr als Hilfsarbeiter im Militärbauamt in Rendsburg. Ab April 1911 kam er zur weiteren Ausbildung in das Staatsarchiv Schleswig, wo er zunächst unentgeltlich beschäftigt, im Juli als Büroassistent auf Probe und ab Januar 1912 als Archivkanzlei-Sekretär angestellt wurde. Meggers wurde am 02. August 1914 zum Militärdienst einberufen und war zuletzt Unterzahlmeister der Reserve-Pionier Kompanie 83 der 80. Reserve Division. Er verstarb 1917 infolge der Kriegsdienstbelastungen an einem Herzinfarkt und wurde in der Kriegsgräberstätte Salomé (Flandern) beerdigt.
[1] Vgl. GStA PK, I. HA Rep. 210, Nr. 76.
[2] Vgl. Sterberegister Berlin, 1774 - 1986, Landesarchiv Berlin, P Rep. 570 Standesamt Deutsch-Wilmersdorf (Wilmersdorf) von Berlin, Nr. 1345.
[3] Vgl. Sterberegister Berlin, 1774 - 1986, Landesarchiv Berlin, P Rep. 380 Standesamt Berlin Neukölln, Nr. 83.
[4] Vgl. Melms, Carl-Philipp: Vom Rittergut zur städtischen Domäne. Berlin 1957, Seite 63 f.
[5] GStA PK, I. HA Rep. 178 Generaldirektion der Staatsarchive, Nr. 2004, Blatt 221.
[6] Vgl. ebenda, Blatt 221 ff.
[7] Die Kurzbiografien erstellte Dr. Johanna Aberle anlässlich der Vitrinenausstellung „Die Welt ist voller Morden“, die im Rahmen des Themenjahres der Stiftung Preußischer Kulturbesitz „1914. Aufbruch. Weltbruch“ im Zeitraum 2014 - 2018 im GStA PK gezeigt wurde. Sie sind zudem in der Veröffentlichung „Aberle, Johanna: Dokumentation der „Gefallenen der Preußischen Staatsarchive, 1914 – 1918“ zur Archivalienpräsentation „Die Welt ist voller Morden“ 2014 – 2018 im Geheimen Staatsarchiv PK. Selbstverlag des Geheimen Staatsarchivs. Berlin 2017“ abgedruckt. Für das Dossier wurden die Texte gekürzt.
Quellen
GStA PK, I. HA Rep. 178 Generaldirektion der Staatsarchive, Nrn. 1400, 1401, 1472, 1475, 1544, 1581, 1598, 1604, 1642, 1643, 1699.
Literatur
- Aberle, Johanna: Dokumentation der „Gefallenen der Preußischen Staatsarchive, 1914 – 1918“ zur Archivalienpräsentation „Die Welt ist voller Morden“ 2014 – 2018 im Geheimen Staatsarchiv PK. Selbstverlag des Geheimen Staatsarchivs. Berlin 2017.
- Beck, Friedrich / Neitmann, Klaus: Lebensbilder brandenburgischer Archivare und Historiker, Berlin 2015.
- Leesch, Wolfgang: Die deutschen Archivare 1500 - 1945. Biographisches Lexikon, Band 2. München u. a. 1992.
- Melms, Carl-Philipp: Chronik von Dahlem. Berlin 1957.