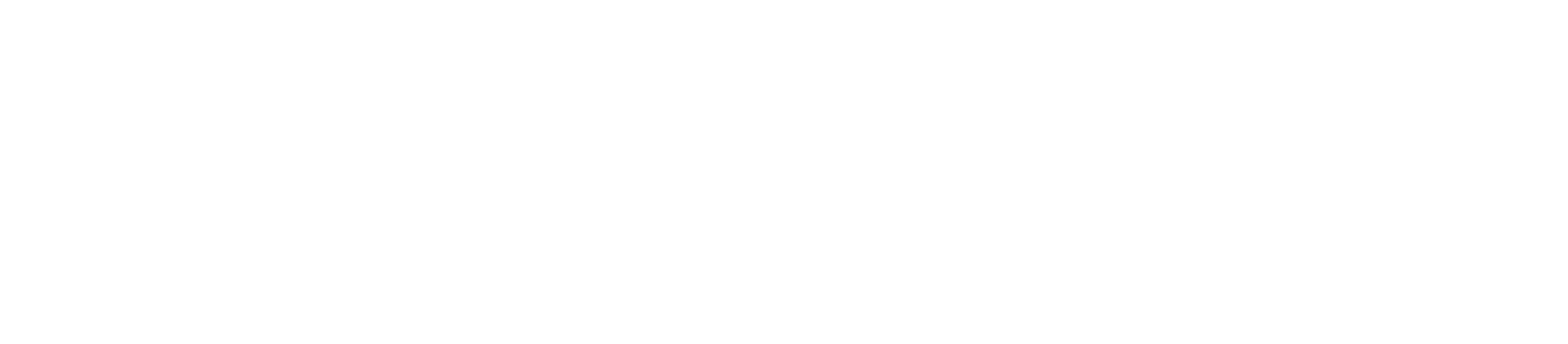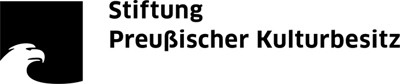Bereichsnavigation
Die Helden der Niederlage
News vom 20.05.2025
Der Sieg Napoleons 1806, die totale Niederlage Preußens eröffneten ganz unerwartete politische Gestaltungsräume – und zwar für solche preußischen Staatsmänner, die für sich den Anspruch hatten und dafür auch das – nach ihrem Selbstverständnis – notwendige wissenschaftliche Rüstzeug mitbrachten, den preußischen Staat neu zu gestalten.
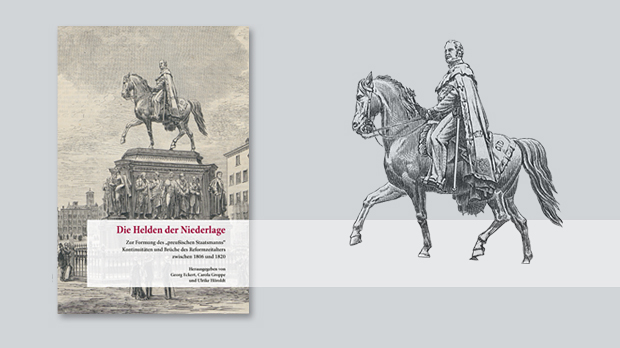
„Der preußische Staat ist untergegangen, und es entsteht jetzt bei dem erfolgten Frieden [Tilsit, 7. und 9. Juli 1807] ein neuer Staat. [...] Es muss eine neue Schöpfung eintreten.“ – so schon Altenstein in seiner Denkschrift, Riga, 11. September 1807.
Auch mit Blick auf das Personal war die Niederlage ohne Zweifel ein Bruch, auch wenn dieser weniger krass durchschlug. So mancher verlor sein Amt, aber es änderte sich nicht alles: Denjenigen, die sich schon vor 1806 als Neuerer verstanden hatten, eröffneten sich auf einmal ganz neue Gestaltungsspielräume und Handlungsmöglichkeiten, um ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in beruflichen und privaten Beziehungsgeflechten, in ihren Netzwerken und Ämtern zu entfalten. Und bei aller Heterogenität betrieben diese Spitzenakteure der Verwaltung obendrein untereinander eine wechselbezügliche „Selbstverständigung“ oder Selbstvergewisserung, die nach innen und außen quasi autoritätsmehrend kommuniziert wurde.
Es lohnt sich, die Aufmerksamkeit auf diejenigen Personen zu richten, die sich schon vor 1806 in der preußischen Verwaltung bewährt hatten und die mit dem historischen Wendepunkt 1806 als „Gestalter unvermeidbarer Veränderungen“ hervortraten.
Die Beitragenden zu dem Sammelband „Helden der Niederlage“ unternehmen schlaglichtartig den Versuch, die Konturen dieser Gemeinschaft der Reformer aufzuzeigen, und zwar nicht nur von denjenigen, die mit Pathos überfrachtet sind und anschließend zum Mythos stilisiert wurden, sondern – und zwar exemplarisch – gerade auch von den vielen anderen, die zwischen 1806 und 1820 die „Reformen verantwortlich planten und weisungsbefugt dirigierten“ (Groppe). Es gilt, dieses Pathos ebenso zu erforschen und zu hinterfragen wie die Herkunft, Erziehung und Ausbildung, die Karrieren, den Dienstalltag und die Weltbilder der Akteure.
Auffällig sticht das Phänomen der Heroisierung der Akteure als eine (selbst-) konstruierte Gemeinschaft hervor. Die Reformer begriffen sich als Retter des Staates aus höchster Not und es gelang ihnen darüber hinaus, sich als solche zu inszenieren. In einzel- und kollektivbiografischen Diskursen gelten die strukturgeschichtlichen sowie sozial-kulturellen Fragestellungen: Wie gelang dies in der Selbstwahrnehmung und in der Fremdwahrnehmung des Einzelnen und in der Gruppe und darüber hinaus auch in der Rezeption? Denn der performative Charakter dieser Selbstinszenierung und Selbststilisierung gerade auch als Teil einer Gruppe diente wie selbstverständlich als Mittel einer individuellen wie kollektiven Heroisierung.
Mit den „Helden der Niederlage“ liegt jetzt der Folgeband zu den Diskursen über Herkunft, Erziehung und Ausbildung „Preußischer Staatsmänner“ zwischen 1740 und 1806 (VAPKF 21,1) vor. Die Herausgebenden haben für diesen zweiten Sammelband wieder die Ergebnisse eines Workshops (März 2023 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte – heute: Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte –, als Fortsetzung der Tagung vom Oktober 2021) in drei Sektionen mit acht Beiträgen sowie einer umfassenden Einleitung zusammengetragen. Wie schon für die erste Tagung hat das Geheime Staatsarchiv PK auch jetzt wieder gern die Beiträge dieses zweiten Workshops in seine amtliche Reihe aufgenommen und dankt den Herausgebenden für die umsichtige Zusammenstellung.
Paul Marcus
Die Helden der Niederlage. Zur Formung des „preußischen Staatsmanns“. Kontinuitäten und Brüche des Reformzeitalters 1806 bis 1820. Hrsg. v. Georg Eckert, Carola Groppe und Ulrike Höroldt (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Forschungen Band 21,2), Berlin Duncker & Humblot 2025
VI, 301 Seiten
Print <ISBN 978-3-428-19297-7> geb., € 89,90