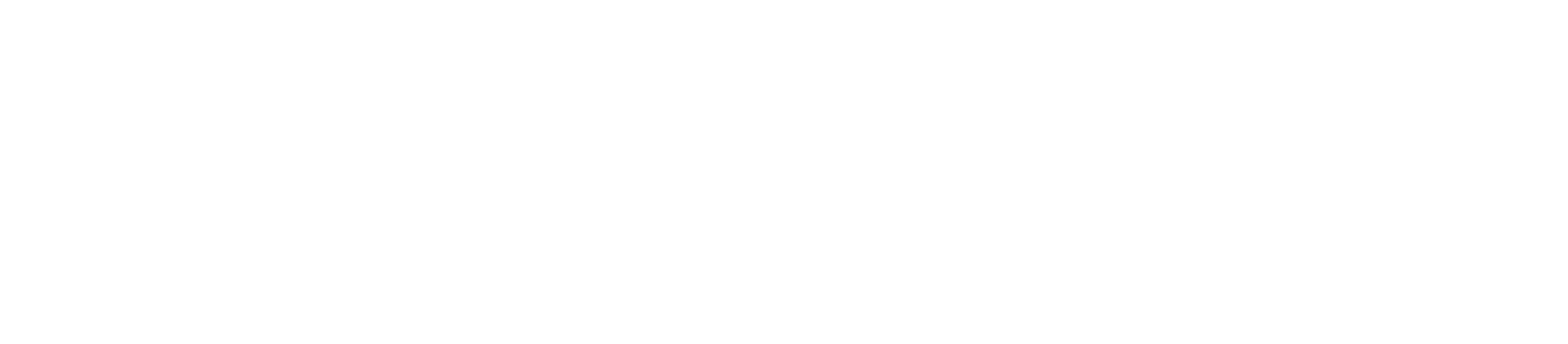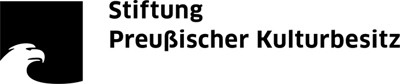Bereichsnavigation
„Stutterheim auf Inspektion“
News vom 16.12.2024
Eine im Autografenhandel erworbene Sammlung mit Kabinettsordres von Friedrich II. an seinen Inspekteur Joachim Friedrich von Stutterheim bringt Licht in das Retablissement der ostpreußischen Infanterieregimenter. Hielt es den Erwartungen des Königs stand?
![Joachim Friedrich von Stutterheim. E[berhard Siegfried] H[enne] sc[ulpsit]. Kupferstich im Genealogisch-Militairischen Calender auf das Jahr 1789 Joachim Friedrich von Stutterheim. E[berhard Siegfried] H[enne] sc[ulpsit]. Kupferstich im Genealogisch-Militairischen Calender auf das Jahr 1789 (QLV 3.1.2.), 7. Monatskupfer](/fileadmin/user_upload_gsta/02_Content/Bilder/NewswallTeaser/Newswall_2024/Newswall_Stutterheim_auf_Inspektion_ct_.jpg)
Am Ende des Siebenjährigen Krieges
1763 endete mit dem Frieden von Hubertusburg der Siebenjährige Krieg. Der territoriale status quo der Vorkriegszeit wurde wiederhergestellt – Preußen stieg zur fünften Großmacht in Europa auf.
Jetzt galt es, das zerstörte Land wiederaufzubauen und die vom Krieg zermürbte preußische Armee wiederaufzustellen. Zu diesem Zweck delegierte Friedrich II. ein Inspektionswesen, um so quasi von unten und aus sich selbst heraus – aber selbstverständlich unter ständiger Beobachtung und Kontrolle – die „abgenutzten“ Regimenter zu regenerieren und zu reorganisieren. Mit der Inspektion der ostpreußischen Infanterieregimenter betraute der König als Generalinspekteur Joachim Friedrich von Stutterheim.
Quellenlage und neuen Quellenfunde
Gerahmt wird das Dokumentationsunternehmen von der bekanntermaßen insgesamt dürftigen (das Heeresarchiv in Potsdam ging 1945 im Bombenkrieg fast vollständig verloren), im vorliegenden Fall aber ganz ungewöhnlichen Quellensituation: Denn 2013 konnte das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz im Autografenhandel aus unbekanntem Privatbesitz eine Kabinettsordres-Sammlung erwerben, die wohl ursprünglich aus Stutterheims Nachlass stammte. Diese Sammlung wird ergänzt von der eigenen Kabinettsminüten-Überlieferung und von Quellen aus anderen Provenienzen. So konnte der Bearbeiter, der vormalige Direktor des Geheimen Staatsarchivs PK, Jürgen Kloosterhuis, im Kern seiner Studie 175 Quellen (Kabinettsordres, Kabinettsminüten und Dokumente anderer Provenienzen) aus der Zeit von 1763 bis 1783 in ganz unterschiedlicher Dichte ermitteln und analysieren, die Friedrich an seinen Inspekteur in Ostpreußen richtete.
Machtworte des Königs – was nutzen sie
Mit umfassenden Erschließungsinstrumenten versehen, werden diese Quellen als Regesten nach allen Regeln der Kunst präsentiert. Aus den Quellen lassen sich das Verhältnis des Königs zu seinem Inspekteur ablesen, seine Anforderungen und Erwartungen, und wie der König mit seinem Untergebenen umging. Zudem erhellen sie die Chancen und Möglichkeiten bei der Erfüllung dieses gar nicht so einfachen Auftrags. Nicht nur, dass Ostpreußen während des Siebenjährigen Krieges von russischen Truppen besetzt gewesen war, obendrein hatten die Stände der Zarin Elisabeth allzu bereitwillig ihre Huldigung erwiesen. Waren die Rahmenbedingungen und die Aufgabe selbst sowie die Möglichkeiten ihrer Bewältigung schon schwierig genug, so kam verschärfend hinzu, dass die ostpreußischen Regimenter, ob zu Recht oder Unrecht, wie der Bearbeiter konstatiert, militärisch in Verruf geraten waren, und sie sich auch danach – trotz aller Reorganisationsanstrengungen – im Vorfeld der Ersten Teilung Polens 1792 und beim Bayerischen Erbfolgekrieg 1778/79 wenig entsprechend den königlichen Erwartungen hervortaten. Die Vorbereitungen der Truppen liefen viel zu schleppend. Der Monarch griff immer fordernder und bis in das kleinste Detail durch und überschüttete seine Offiziere mit immer heftiger werdenden Anwürfen und Drohungen. Dies führte zu nicht unerheblichen Spannungen und zum Teil auch zu drastischen und handgreiflichen Formulierungen und Maßnahmen. Letztlich gelang Stutterheim das Geforderte einigermaßen, jedoch nur unter erheblichem Druck. Wie Monarch und Inspekteur taktierten, und wie sich ihr Verhältnis gestaltete, davon können sich Leserinnen und Leser selbst ein Bild machen; und schließlich mit dem Autor der Frage folgen: „harmonierten oder kontrastierten die schriftlichen Quellen mit einem Porträt, das er [Stutterheim] ca. 1768/70 von sich malen ließ?“ – so Jürgen Kloosterhuis.
Methodische Stringenz par excellence
Quellenkritische Analyse und Quellenedition kommen in dieser militärgeschichtlichen Spezialstudie beispielsetzend zusammen. Die Dokumentation ist gleichermaßen aufschlussreich für militärgeschichtlich Interessierte und Versierte wie auch für angehende Forschende, die hier der methodischen Stringenz einer historischen Mikrostudie folgen können. Und schließlich nimmt die Studie alle mit, die sich für Friedrich den Großen interessieren, denn etwas von seiner Persönlichkeit schimmert aus dieser Korrespondenz und im Umgang mit dem ihm untergebenen Inspekteur hervor – so wie auch dieser mit seinem König umzugehen wusste. So unterlegt der Quellenteil die Einführung und steht gleichermaßen für sich selbst, denn gerade in den Quellen lassen sich die Antworten finden. Paul Marcus
„Stutterheim auf Inspektion“
Schlaglichter auf das Retablissement der ostpreußischen Infanterie 1763–1783.
Dokumentation. Bearbeitet bearb. von Jürgen Kloosterhuis
(Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz / Quellen, Band 76)
Duncker & Humblot, Berlin 2024
Abb. X, 159 Seiten
Print <ISBN 978-3-428-19289-2>
geb. € 69,90