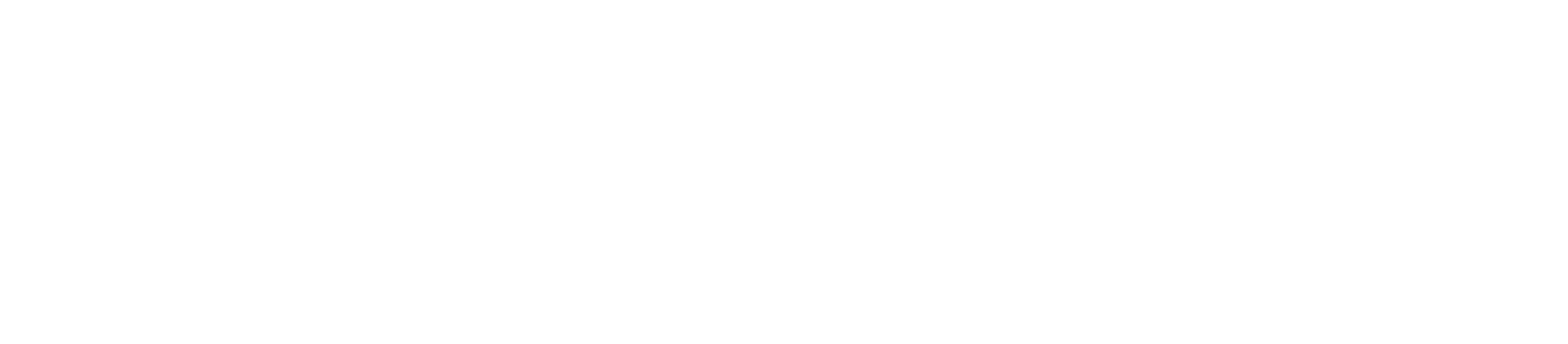Bereichsnavigation
Briefgeheimnis endlich gelüftet
News vom 14.08.2018
SPK-Stipendiatin entdeckt in Akten einen über 200 Jahre verschlossen gebliebenen Brief
Die Anspannung war groß bei diesem außergewöhnlichen Zusammentreffen in der Restaurierungswerkstatt des Geheimen Staatsarchivs und es ist nur schwer zu sagen, bei wem sie größer war. Bei den Restauratorinnen Heike Sommerfeld und Sabine Thimm, die einen verschlossenen Brief aus dem 18. Jahrhundert vorsichtig zu öffnen versuchten, ohne dabei das rote Lacksiegel zu beschädigen, oder bei den Historikerinnen Francisca Hoyer und Claudia Jarzebowski, die es kaum erwarten konnten, endlich seinen Inhalt zu erfahren. Francisca Hoyer, Doktorandin an der Universität Uppsala in Schweden, hatte den Brief an einem der letzten Tage ihres zweimonatigen Stipendiums im Geheimen Staatsarchiv bei der Suche nach Material für ihre Dissertation über Deutsche in Ostindien und ihre Familien im 18. Jahrhundert zufällig in den Akten entdeckt und sofort eine Mail über den ungewöhnlichen Fund an ihre Mentorin Claudia Jarzebowski am benachbarten Friedrich-Meinecke-Institut geschickt.
Frau Hoyer, wer hatte den Brief geschrieben und was steht in ihm?
Der Absender des Briefes war Hauptmann von Struve, der seit 26 Jahren im Dienst der Niederländischen Ostindienkompanie auf Ceylon (heute Sri Lanka) stand. 1799, als er den Brief schreibt, ist er englischer Kriegsgefangener in Colombo. Adressiert ist der Brief an seine Ehefrau, die Hauptmännin von Struve in Berlin, die er seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte und die seit über zwei Jahren keine Nachricht und auch keine Unterhaltszahlungen mehr von ihrem Mann erhalten hatte. Die "schreckliche Ungewissheit" über das Leben oder den Tod ihres Mannes hatte sie in das "tiefeste Elend" gestürzt, wie sie selbst schreibt. Vor diesem Hintergrund erscheint der Inhalt des jetzt geöffneten Briefes recht hart. Hauptmann von Struve kritisiert seine Ehefrau nämlich, dass sie sich, um Nachricht von ihm einzuziehen, an den preußischen König und dessen Minister in London gewandt hatte und nicht, wie vereinbart, an seine Bevollmächtigten in Amsterdam. Nur knapp teilt er seiner Frau mit, dass er wieder gesund sei und, wenn es die Umstände erlaubten, bald wieder nach Europa reisen wolle. Tragischerweise erreichte der Brief die Hauptmännin von Struve nicht mehr. Zwei Jahre, bevor der Brief in Berlin ankam, war sie gestorben.
Sie untersuchen in Ihrer Dissertation 300 Fälle von Deutschen in Ostindien. Inwiefern stellt dieser Fall eine Besonderheit dar?
Zunächst ist es bemerkenswert, dass ein ungeöffneter Brief hier in den Akten des Geheimen Staatsarchivs überliefert wurde. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass sich die Hauptmännin von Struve erstens hilfesuchend an den König bzw. seine Kabinettsminister gewandt und sie somit zu Vermittlern gemacht hatte. Zweitens dauerte die Nachrichtenübermittlung zwischen Europa und Ceylon zu jener Zeit fast zwei Jahre, und die Hauptmännin war, wie schon gesagt, bereits verstorben, als der Brief endlich ankam. Neben der Besonderheit dieser Überlieferungssituation ist die extrem lange Trennung des Ehepaares bemerkenswert. Das Paar lebte 24 Jahre lang getrennt und während dieser Zeit kam Hauptmann von Struve nur einmal nach Europa. Gleichzeitig ist der Fall nicht besonders bemerkenswert in dem Sinne, dass viele meiner Fälle auf flexible Familienpraktiken hinweisen, in denen Familien über weite Distanzen und lange Zeiten der Trennung hinweg gelebt haben und kreative Lösungen gefunden wurden, Phasen der Abwesenheit zu überbrücken.
Für eine Historikerin liegt es im Zeitalter der Globalisierung nahe, die Frage nach Mobilität in früheren Zeiten zu stellen. Doch wie sind Sie, Frau Hoyer, ausgerechnet auf die Idee gekommen, sich mit Deutschen, die im 18. Jahrhundert nach Ostindien gingen, zu beschäftigen? Und was verstehen Sie eigentlich unter "Ostindien"?
Ich fange mit der Frage nach Ostindien an. Grob und kurz gesagt ist Ostindien ein historischer Begriff, eine zeitgenössische Beschreibung für die Regionen östlich des Kaps der guten Hoffnung bis nach China und Japan, in denen die sogenannten Ostindischen Handelskompanien tätig waren. Warum das Thema? Ja, es liegt auf der Hand heute danach zu fragen, wie Globalisierung in der Vergangenheit funktionierte oder auch nicht funktionierte, wie Menschen mit Mobilität umgingen und wie Beziehungen über Distanzen hinweg aufrechterhalten wurden und wann und wie sie abbrachen. Das 18. Jahrhundert ist hier besonders spannend, da es uns Alternativen und Möglichkeiten aufzeigt, Familie und Mobilität sowie Globalisierung zu denken. Ausgangspunkt für das Projekt war meine Masterarbeit, in der ich mich mit dem Leben Christoph Adam Carls von Imhoff beschäftigte. Imhoff ging in den frühen 1770er Jahren mit Frau und Kind nach Madras (heute Chennai) und dann weiter nach Calcutta (heute Kolkata). Die rund 100 Briefe, die von Imhoff überliefert sind, überraschten mich in vielerlei Hinsicht und waren erklärungsbedürftig. Nach der Masterarbeit ging ich an einem freien Tag ins Geheime Staatsarchiv und gab auf gut Glück den Suchbegriff "Ostindien" in die Archivdatenbank ein. Ich hatte nicht mit einer so hohen Trefferzahl gerechnet. Außerdem warfen die so identifizierten Akten wiederum neue Fragen auf: Was passierte eigentlich, wenn die Ostindienfahrer in Ostindien verstarben? Wie gingen die zurückgebliebenen Familien, sowohl die in Deutschland als auch in Ostindien, damit um?
Wie haben Sie die 300 Einzelfälle, die Sie näher untersuchen, in den Archiven gefunden?
Ja, es sind zurzeit um die 300 Fälle; die Zahl derjenigen, die im 18. Jahrhundert aus dem Alten Reich nach Ostindien gingen, ist natürlich deutlich höher. Ich habe ganz verschiedene Recherchemethoden angewandt mit dem Ziel, ein breites Spektrum an Akteurinnen und Akteuren zu identifizieren. Das bedeutet, dass die Konzentration auf einen einzelnen Bestand von vornherein ausgeschlossen wurde. Neben der systematischen Recherche in den Archiven der britischen und niederländischen Ostindienkompanien in London und Den Haag waren die Online-Findmittel und integrierten Datenbanken der Deutschen Landes- und Staatsarchive von besonderer Bedeutung bei der Suche. Ohne diese Datenbanken wäre es mir nicht möglich gewesen, eine solche Bandbreite an Fällen aus verschiedenen Territorien des Alten Reiches zu finden.
Sie nennen die Vorteile, die sich mit dem Einzug der Digitalisierung in die Archive ergeben. Doch wo stoßen Sie bei der Herangehensweise mit Digital Humanities auch an Grenzen?
Die große Herausforderung der Benutzung solcher Online-Findmittel und -Datenbanken ist, dass sie schnell eine Vollständigkeit suggerieren. Man muss sich also darüber Kenntnis verschaffen, was wie online suchbar ist und welche Mechanismen und Interessen hinter der Digitalisierung von Archivbeständen stehen. Der Suggestion von Vollständigkeit muss also widerstanden werden. Konkret bedeutet das, dass die Recherche in Online-Datenbanken immer nur ein erster Schritt sein kann. Im nächsten Schritt bin ich dann an die "alten", teilweise sogar noch handschriftlichen Findmittel gegangen. Für beide Suchwege gilt, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Akten nicht in Hinblick auf mein Dissertationsthema betitelt wurden, sondern entsprechend zeitgenössischer Verwaltungslogiken und der Kontexte, in denen sie entstanden. Eine Akte muss also nicht zwangsläufig betitelt sein mit "Die Erbschaft des Tuchmachers Müller in Ostindien betreffend", sondern kann auch einfach heißen "Des Tuchmachers Müller Nachlass in Amsterdam betreffend". In der Praxis heißt das, kreativ zu sein, viele Quellen zu lesen, Bestände durchzublättern und auch mal eine Akte auf gut Glück zu bestellen.
Inwieweit geben die von Ihnen herangezogenen Quellen Aufschlüsse über die neuen familiären Beziehungen, die die Auswanderer in Ostasien oftmals eingingen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich im Verlauf des Projekts durch die Quellenarbeit immer mehr herauskristallisierte. Besonders Testamente sind hier hervorzuheben, denn sie eröffnen Einblicke in Familienformationen in Ostindien, von denen wir bisher noch nicht viel wissen. Das sind Familienformationen, in denen beispielsweise Sklavinnen und Sklaven, auch Kindersklaven, eheliche und nach christlichen Maßstäben uneheliche Kinder, Ehefrauen und Konkubinen integriert wurden. Das Projekt setzt diese neuen Familien in Ostindien mit den zurückgelassenen Familien in Deutschland in Beziehung, verortet sie also im selben analytischen Feld. In einigen Fällen stellen auch die Familien selber ganz konkrete Beziehungen her. Die Witwe von Joachim Spiegel in Bengalen (heute Westbengalen) korrespondierte beispielsweise mit ihren Schwägerinnen in Wittstock und Perleberg. Es konnte natürlich auch zu Spannungen kommen zwischen diesen Familien. So zweifelte der Bruder des in Makassar (auf der indonesischen Insel Sulawesi) verstorbenen Christoph Gottfried Jäger die Rechtmäßigkeit einer Adoption in Ostindien an, durch die er in der Erbfolge übergangen wurde.
Welches Ergebnis hat Sie bei Ihrer Arbeit am meisten überrascht?
Das sind zum einen diese sehr bewegten Familien, von denen ich gerade gesprochen habe und die sich nicht so einfach in unser Wissen und unsere Vorstellungen von Familie im 18. Jahrhundert einfügen lassen. Im Gegenteil fordern uns diese Familien immer wieder heraus, die Perspektive zu wechseln und nicht ausschließlich mit europäischen Brillen auf die hier stattfindenden Familienpraktiken zu schauen. Zum anderen überrascht mich immer wieder die Unbedarftheit und Offenheit, mit der Menschen "in die Fremde" gingen, sich auf Neues einließen und Familienbeziehungen über Distanzen hinweg „hantierten“. Und schließlich ist es die Einsicht, dass Globalisierung nicht zwangsläufig ein immer mehr an Beziehungen bedeutet, sondern auch ein Abbrechen von Beziehungen, wie sehr viele der Fälle bezeugen. Deutlich wird dies beispielsweise an den Sklavinnen und Sklaven, die aus ihren eigenen Familien herausgerissen wurden. Und man sieht es an der Struve Familie, in der durch Krieg, die Schwierigkeiten der Briefkommunikation und die lange Dauer der Übermittlung von Informationen Beziehungen unter- und schließlich abgebrochen werden. Das sind bislang die Punkte, die mich selbst am meisten bewegen und immer wieder überraschen.
Und was war bisher das ungewöhnlichste Erlebnis bei Ihren Recherchen in den Archiven?
Das war mit Sicherheit der ungeöffnete Brief von Hauptmann von Struve an seine Ehefrau. Das Öffnen des Briefes hat mich durchaus mit einer gewissen Ehrfurcht erfüllt, dass ich nun 2018 als erste erfahren darf, dass von Struve noch gesund und am Leben war - eine Information, die seiner Frau so viel bedeutet hätte. So ein Fall macht diese Akteurinnen und Akteure als Menschen greifbar, die die neuen Formen und Möglichkeiten von Globalität im 18. Jahrhundert formten und realisierten, lebten und erlitten.
Die Fragen stellte Dr. Ingrid Männl vom Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz